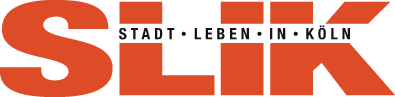Johanna Meier ist eine 21-jährige Studentin, die ein von der FH Köln initiiertes Stipendium für eine Business Universität in China erhalten hat. Der vierwöchige Aufenthalt beinhaltete Reisen nach Peking und Shanghai, sowie die Teilnahme am „Summer-School“-Programm der Dongbei University of Finance and Economics in Dalian. Hier berichtet Sie nun für euch wöchentlich über Ihre Erfahrungen, Erlebnisse und Eindrücke, die sie während dieser Zeit gesammelt hat. Hier nun die zweite Folge „In China isst man Hunde„:
Johanna Meier ist eine 21-jährige Studentin, die ein von der FH Köln initiiertes Stipendium für eine Business Universität in China erhalten hat. Der vierwöchige Aufenthalt beinhaltete Reisen nach Peking und Shanghai, sowie die Teilnahme am „Summer-School“-Programm der Dongbei University of Finance and Economics in Dalian. Hier berichtet Sie nun für euch wöchentlich über Ihre Erfahrungen, Erlebnisse und Eindrücke, die sie während dieser Zeit gesammelt hat. Hier nun die zweite Folge „In China isst man Hunde„:
Ein modrig- fauliger Geruch strömte mir entgegen, als ich das erste Mal einen chinesischen Markt durchquere, der mich so intensiv durchdrang, als hätte er den Auftrag meinem Magen den Befehl „Entleeren!“ zu erteilen. Doch ich riss mich zusammen und passierte mit zugehaltener Nase tapfer den Obststand, wo große Früchte mit stachelartigem Panzer gestapelt auf einem mit Schmutz befleckten Warentisch gestapelt lagen. „Durian“ werden diese Früchte genannt, von denen der an Fäule erinnernde Geruch herrührte.
Ein Leibgericht der Chinesen, das Gerüchten zu folge gut schmecken sollte. Doch der Gestank hinderte mich daran auch nur einen Gedanken an das Probieren zu verschwenden. Also liefen wir weiter, vorbei an lebenden Meeresfrüchten in den aufregendsten Farben und Formen, Hautfetzen ähnelnden Kriechtieren und Käfigen mit lebenden Kreuzungen aus Hund und Meerschweinchen, die darauf warteten, verspeist zu werden. Am meisten staunte ich über die verkohlt dreinschauenden Seegurken, die meistens exquisit verpackt hinter Glasvitrinen zur Schau gestellt wurden und von einem Preisschild mit einer endlos langen Reihe von Nullen hinter der ersten Ziffer geschmückt wurden. Von den Chinesen wird diese gummiartige Seegurke nämlich als Delikatesse angesehen, die mit unter zu den gesündesten und teuersten Speisen zählt.
Zwischen blutverspritzten Metzgerständen und zur Pyramide drapierten Hühnerbeinen bereiteten alle zwei Meter kleine Chinesen mit verdreckten Händen undefinierbare Fleischspieße an ihren Garküchen zu, die zuvor auf dem Boden daneben vorbereitet wurden. Fiel etwas in den Dreck, wurde es ohne Zögern wieder auf den Grill geschmissen. Hygiene war hier ein Fremdwort und der Spruch „Dreck ist gesund“ schien eine Lebenseinstellung zu sein. Deshalb wurde uns schon im Voraus davon abgeraten in den Garküchen auf der Straße zu essen. Manche meiner Mitstreiter taten es trotzdem. Und einige bezahlten dies mit heftigen Magenschmerzen, andere hatten Glück oder – viel wahrscheinlicher – eine aus Hornhaut bestehende Magenschleimhaut.
Es gibt Reis
Um einiges gepflegter und angenehmer waren hingegen die Restaurants – zumindest vor den Kulissen. Die Speisekarten waren fast immer ohne englische Übersetzung und so konnten wir uns nur an den abgebildeten Fotos orientieren und hoffen, dass sich kein Hund hinter dem nach Rindfleisch aussehenden Fleischgemenge verbarg. Einige Experimentierfreudige wagten sich jedoch absichtlich an Hühnerköpfe, Entenherzen und ja – auch an Hundefleisch. Ich aß einfach und war froh, nicht erfahren zu müssen, ob mein Essen in einer glücklicheren Phase seines Daseins einmal gequakt, gebellt oder miaut hatte.
Und ja: Es gab Reis. Klebrigen Reis, dunklen Reis, Reis mit Ei, wässrigen Milchreis. Manche flüchteten schon nach der ersten Woche regelmäßig zu Pizza Hut, um ihre Pasta-Gelüste zu stillen, andere beteiligten sich an der Umsatzsteigerung des örtlichen Mc Donalds. Der Rest arrangierte sich und wurde oft von den Chinesen für das äußerst ungeschickte Handtieren mit den Stäbchen belächelt. Doch solange keiner von uns aus einem Moment der Frustration die Stäbchen in den Reis steckte, war alles in Ordnung, da Stäbchen in Reis gesteckt in China ein Symbol für den Tod darstellen.
All diese Startschwierigkeiten wurden jedoch nach kurzer Aufwärmphase beseitigt und so wurde auch das zu Beginn von Kommunikationsschwierigkeiten überschattete Bestellen im Restaurant zur Routine. Hatten wir ansprechende Bilder in der Speisekarte auserkoren, wurde gemeinsam an einem großen Tisch durch Zeigen, wildes Artikulieren und Köpfe Schütteln bestellt. Im Fünf-Minuten-Takt wurden diverse Speisen auf Platten gereicht, die in der Mitte – meist auf einer Drehscheibe – positioniert wurden. Auf diese Weise konnte Jeder von Allem kosten und es entstand dadurch eine einzigartige und ganz besonders gemütliche Atmosphäre.
Wir merkten schnell, dass es in dieser Esskultur nicht in erster Linie um die Nahrungsaufnahme an sich geht, sondern vielmehr um das Zusammengehörigkeitsgefühl beim Essen, und somit die eigentliche Absicht zur Nebensache wird. Vielleicht auch der Grund, warum für uns das Essengehen in der großen Gruppe immer zum besonderen Erlebnis wurde und diese Abende mitunter die schönsten waren.
Der Gesellschaftscode „guanxi“
Bei Tisch ist die Rangordnung und die damit verbundene Vorgehensweise von großer Bedeutung. Als uns der Dekan der Dongbei University in der ersten Woche zum Essen einlud, war es noch etwas befremdend für uns, als er seinem Sitznachbarn Reis auf den Teller schöpfte. Wir erfuhren, dass es in China üblich sei, seinen Gästen Essen aufzuladen, und zwar in hierarchisch abfallender Form, der Ranghöhere dem Rangniederen, um seinen Gästen Respekt zu erweisen, aber auch um seine Position zu verdeutlichen. Besondere Freude verschaffte uns der Brauch, seinen Gästen immer wieder 70-prozentigen Reisschnaps, der geschmacklich an eine Mischung aus Formalin und Kerosin erinnerte und „Pijiu“ (Bier) nachschenken zu lassen. Traditioneller Weise wurde dies nach einer kleinen Rede des Dekans und dem Schlachtruf „Ganbei“, was so viel wie „ex“ bedeutet, hinuntergestürzt und im Laufe des Abends mehrere Male wiederholt, was wir anstandshalber und natürlich aus rein gesellschaftlichen Gründen über uns ergehen ließen.
Diese ritualartigen Abläufe beim Essen sind ein wichtiger Bestandteil der chinesischen Kultur. Dadurch wird die Bedeutsamkeit zwischenmenschlicher Beziehungen demonstriert, was unter dem Begriff „guanxi“ zusammengefasst wird. In China ist es wichtig, ja fast sogar lebensnotwendig, ein Netzwerk aus persönlichen Beziehungen zu besitzen und diese zu pflegen, da ohne sie das komplizierte Gesellschaftskonstrukt nicht funktionieren würde. So bleibt kaum eine Entscheidung von dem Geflecht aus Beziehungen unbeeinflusst. Hier wird nach der Devise „eine Hand wäscht die andere“ gelebt und so ist es egal, wer am Ende des Abends die Rechnung begleicht, da man sich sicher sein kann, ein andermal auch eingeladen zu werden.