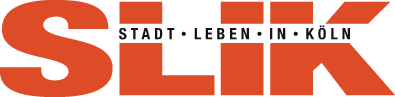Herr Emmerich, Sie sind jüngst 60 geworden und können schon auf eine Reihe sehr bekannter Blockbuster unter Ihrer Regie zurückblicken (darunter etwa ganz unterhaltsam „10.000 BC“ und „2012“). Sehr beachtlich. Ihr neuster Streich heißt „Stonewall“. Und an diesem gibt es allerdings so manches auszusetzen: Klischee, olé.
Herr Emmerich, Sie sind jüngst 60 geworden und können schon auf eine Reihe sehr bekannter Blockbuster unter Ihrer Regie zurückblicken (darunter etwa ganz unterhaltsam „10.000 BC“ und „2012“). Sehr beachtlich. Ihr neuster Streich heißt „Stonewall“. Und an diesem gibt es allerdings so manches auszusetzen: Klischee, olé.
„Stonewall“ spielt zum Ende der 1960er Jahre in New York. Die 60er und 70er waren bekanntlich Jahrzehnte, in denen in vielen Ländern junge Menschen gegen verkrustete gesellschaftliche Strukturen, gegen das sogenannte Establishment, den Krieg sowie verschiedene Unrechtsformen aufbegehrten. Von diesem Zeitgeist getragen begannen sich auch zunehmend Homosexuelle zu organisieren, und gegen Restriktionen, Diskriminierungen und für ihre Rechte auf die Straße zu gehen. Als glorifizierter Ursprung aller Christopher Street Days und der LGBT-Community (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) gelten die Tumulte in der Christopher Street (New York) vor der Szene-Bar „Stonewall“ am 28. Juni 1969, bei denen man sich erstmals massiv der willkürlichen Polizeikontrollen widersetze.
Der Film nimmt diesen Schauplatz in den Blick, verbindet reale Geschehnisse und Personen mit fiktiven Figuren. Da ist etwa die fiktive Hauptfigur, Sonnyboy Danny Winters (Jeremy Irvine), der aus einem Nest nach New York flüchtet, weil er unfreiwillig geoutet worden ist. Und das konnte vor allem damals böse ausgehen. In New York findet Danny Anschluss an eine Gruppe queerer, sehr überdrehter Jungs bzw. „Ladyboys“, die in diesem Viertel auf der Straße abhängen und sich prostituieren. In dieser Szene gehören das Feiern, Ausgelassenheit und Freude ebenso dazu wie tagtäglicher Schmerz, Elend und Gewalt. Jeder von ihnen hat diese Ohnmachtserfahrungen und ist Opfer willkürlicher Razzien und von Polizeigewalt. Das ganze Viertel ist ein Pulverfass, das sich irgendwann entladen muss.
„Stonewall“ strotzt nur so von Klischees, schwuler Stereotype und Übersteigerungen. Diversität gibt es hier nicht. Ebenso wie es in Emmerichs Vorstellung dieser Ereignisse wohl auch nur männliche Akteure gibt. Und natürlich ist die einzig lesbische Frau, die dann irgendwann mal kurz an diesem Ort bewusst in den Blick genommen wird, ebenfalls stereotypisch geformt. Herr Emmerich, es heißt, Sie selbst leben mit einem Mann zusammen. Weshalb bedienen Sie sich in einem Film, der vor allem Drama denn Komödie ist, an einem solch‘ abgedroschenen Klischeeallerlei? Gut ist jedoch, dass der Film sehr deutlich die seinerzeitigen (gesellschaftlich akzeptierten) Diskriminierungen und Demütigungen aufzeigt. Ein Bewusstsein dafür schafft. Aber sonst … schwierig, schwierig.
USA 2015, Regie: Roland Emmerich, Kinostart: 19.11.
(Text: Madeleine Owoko, Bild: Warner Bros.)