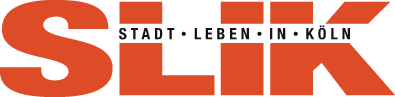Reisen, die Welt in ihrer Vielfalt und Schönheit zu erkunden, sich von neuen Eindrücken beflügeln zu lassen: Ja, überhaupt Neues kennenzulernen und Dinge zu entdecken, die sich nicht innerhalb des gewohnten Umfeldes, der gewohnten Komfortzone befinden – diesen Reiz kennen wohl alle, die neugierig in die Welt blicken und einen Sinn für Abenteuer haben.
Reisen, die Welt in ihrer Vielfalt und Schönheit zu erkunden, sich von neuen Eindrücken beflügeln zu lassen: Ja, überhaupt Neues kennenzulernen und Dinge zu entdecken, die sich nicht innerhalb des gewohnten Umfeldes, der gewohnten Komfortzone befinden – diesen Reiz kennen wohl alle, die neugierig in die Welt blicken und einen Sinn für Abenteuer haben.
Cineastisch wurde dieses Lebensgefühl etwa in „The Beach“ sehr unterhaltsam von DiCaprio verkörpert. Und wie „The Beach“ beruht auch dieser Abenteuerfilm „Die versunkene Stadt Z“ auf wahren Begebenheiten. Nur spielten sich letztere rund 100 Jahre früher ab.
1905 im irischen Cork: Oberstleutnant Percy Fawcett (Charlie Hunnam) bekommt zum Leidwesen seiner Frau Nina (Sienna Miller) und Söhnchen Jack von der Royal Geographical Society die Order, für eine Vermessung und Kartografierung in unerforschte Gebiete des Amazonasbecken zwischen Bolivien und Brasilien zu reisen. Mit seinem Begleiter Henry Costin (Robert Pattinson) macht er sich 1906 nach Bolivien auf, dort wollen sie den Rio Verde bis zu seiner Quelle erkunden. Und hier hört Fawcett das erste Mal die Sage von einer mysteriösen uralten Steinstadt im Dschungel. Als er dann noch die Scherben alter Tongefäße findet, packt ihn völlig der Ehrgeiz, die Stadt, die er Z nennt, zu finden. Aufgrund misslicher Umstände müssen die beiden ihre Expedition schließlich abbrechen, 1908 kehren sie nach England zurück. Dort versucht Fawcett, die Royal Geographical Society von der Existenz der Stadt zu überzeugen. Z wird ihn fortan nicht mehr loslassen. Und so er wird sich wieder und wieder in den Dschungel begeben und auf die Suche machen, allen Gefahren zum Trotz.
Es ist dies ein Epos, der auf David Granns gleichnamigen Buch beruhend das über Jahrzehnte währende Schicksal des Percy Fawcett bzw. das der ganzen Familie Fawcett schildert. Und das recht unterhaltsam und besonders eindrücklich, muss man sagen. Wahrscheinlich werden nicht wenige, die den Film gesehen haben, sich noch weiter über die Thematik informieren. Zumal hier einige Umstände auch nur angedeutet werden. Zu den unschönen Bildern ist vor allem der zeitgenössische selbstgefällige koloniale Diskurs zu zählen, der gerade bei damaligen Expeditionsmotiven immer irgendwie mitschwang. Insbesondere bei den feisten Herren der Royal Geographical Society entblößt sie sich in ihrer ganzen Abscheulichkeit, diese überhebliche, rassistische Kolonialfratze. Andererseits, sehr viel mehr, sind da aber auch die fesselnden naturgewaltigen, spannungsvollen Bilder der Reise und der menschlichen Begegnungen. Fazit: 140 Minuten bewegendes Abenteuer.
USA 2016, Regie: James Gray, Kinostart: 30. März
(Text: Madeleine Owoko, Bild: Studiocanal)