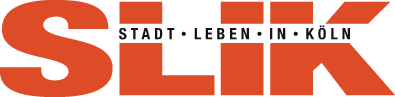Realverfilmung eines Cyberpunk-Klassikers = geiler Scheiß. Whitewashing eines ikonischen Charakters zur hollywoodfreundlichen Umsatzsteigerung = nicht so geiler Scheiß. Dieser Geist ist weißer als Caspar und hat mit dem Ausgangsstoff nur noch den guten Namen gemeinsam. Visuell hui, inhaltlich eher pfui versucht sich die Traumfabrik an dem Stoff, der einst die Matrix-Reihe inspirierte und liefert statt roter oder blauer Pille nur einen Kopfschmerzgarant. Siri, was heißt „billiges Imitat“ auf Japanisch?
Realverfilmung eines Cyberpunk-Klassikers = geiler Scheiß. Whitewashing eines ikonischen Charakters zur hollywoodfreundlichen Umsatzsteigerung = nicht so geiler Scheiß. Dieser Geist ist weißer als Caspar und hat mit dem Ausgangsstoff nur noch den guten Namen gemeinsam. Visuell hui, inhaltlich eher pfui versucht sich die Traumfabrik an dem Stoff, der einst die Matrix-Reihe inspirierte und liefert statt roter oder blauer Pille nur einen Kopfschmerzgarant. Siri, was heißt „billiges Imitat“ auf Japanisch?
Major (Scarlett Johansson) ist ein technologisches Meisterwerk: Nach einem Unfall wird ihr menschliches Gehirn unter der Aufsicht von Dr. Ouelet (Juliette Binoche) in einen künstlichen Hightech-Körper verpflanzt. Nur ein Jahr später ist Major zusammen mit Batou (Pilou Asbaek) Teil der Spezialeinheit Sektion 9, einem Elite-Team, das zur Kriminalitätsbekämpfung eingesetzt wird. Während eines Angriffs trifft Major auf den geheimnisvollen Kuze (Michael Pitt), wie sie mehr Maschine als Mensch, der gegen das System rebelliert. Kuze offenbart ihr, dass alles, was man ihr über ihr vorheriges Leben erzählt hat, eine Lüge ist und bittet sie, sich ihm anzuschließen um zu verhindern, dass noch anderen das gleiche Schicksal wie ihnen zuteil wird.
Natürlich ist Scarlett Johansson in einem semi-transparenten Catsuit ein gutes Verkaufsargument, vor allem wenn man denkt, dass Scarlett Johansson in einem semi-transparenten Catsuit ein Verkaufsargument für einen Film sein soll. Allerdings wird spätestens mit der Auflösung gegen Ende klar, dass es völlig sinnfrei ist, dass Major hier keine Japanerin ist. Immerhin scheint es, als habe man durch das Casten von Takeshi Kitano versucht, zumindest einen Superstar des japanischen Films an Bord zu holen, aber letztendlich wirkt das dann auch nur wie ein Alibi. Besonders ärgerlich ist die Patchwork-Version einer Handlung. Das Original wurde so dermaßen vereinfacht, dass man sich schon fragt, ob man als Zuschauer eigentlich für zu doof gehalten wird, um komplexeren Handlungssträngen folgen zu können. Deshalb gibt es hier auch keinen komplexen „Puppet Master“, sondern eben nur Michael Pitt. Wie singt Adele so schön, „we could have had it aaaaaall“. So bleibt ein hübsch anzuschauendes Spektakel, das wenig Geist in seiner Hülle (hatten wir schon erwähnt, dass diese semi-transparent ist?) hat.
USA 2017, Regie: Rupert Sanders, Start: 30.3.
(Text: Annette Schimmelpfennig, Bild: Paramount Pictures)